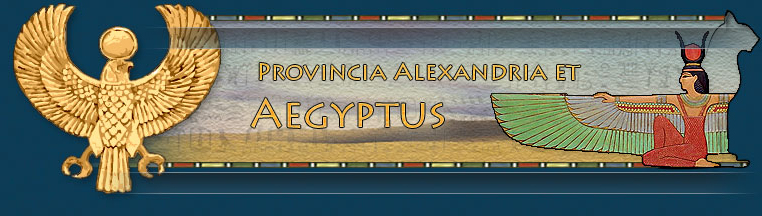Es war stockdunkel, bis auf das kleine, unscheinbare Feuer, dessen Flammen zu ihren Füßen um die letzten, kläglichen Reste vertrockneter Zweige kämpften. Ein Kampf, der dem in ihrem Inneren glich, nur, dass bei diesem das Ende schon feststand.
Es war ein kaum wahrzunehmender Schimmer am Horizont, der ihre Aufmerksamkeit suchte. Erst blieb er unscheinbar, fast durchsichtig, dann wuchs er stetig an. Der rote Streif dort über den Dünen schien sich zu bewegen, waberte flackernd auf und ab, noch immer unbemerkt.
Das Feuer zu ihren Füßen erlosch, sie legte Steine in die Glut und hob den Blick. Reglos auf den Schein gerichtet, spiegelte sich das Rot in ihren Augen wider. Ihr war klar, was es war, sie wußte, es ging sie nichts an, sie war sicher, es war weit genug entfernt. In aller Ruhe wickelte sie die Steine in Tücher, legte sie auf ein Fell und stand damit auf.
Für einen Moment lauschte sie in die Stille. Es war ruhig, ein tonloses Flackern am Horizont, leise Schritte, die sich näherten, dazwischen das leise Schnauben der Tiere. Ihre Zeit der Wacht war zu Ende. Mit einem Fingerzeig wies sie Richtung Horizont. Das leise Danke ihrer Ablösung hallte wie ein Donner durch das Lager, bevor es in der Dunkelheit verstummte. Ebenso still nickte sie ihrem Gegenüber noch zu. Dann verschwand sie in ihrem Zelt.